
Bilddokumente und Informationen zur Geschichte des Dorfes Kuschkow aus der Spreewaldregion in der Niederlausitz
Startseite Kuschkow-Historie Fotografie und Architektur Impressum und Datenschutz
Urheberrecht
Alle auf dieser Seite verwendeten Fotos und Abbildungen sind
urheberrechtlich und nutzungsrechtlich geschützt.
Bildquellen und Rechteinhaber sind jeweils in den Bildunterschriften
oder im Fließtext angegeben, siehe Impressum.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Kuschkow am nördlichen Rand der Niederlausitz
Dies ist die private Website von Doris Rauscher,
aufgewachsen als Doris Jäzosch in Kuschkow, die ältere Tochter des Müllermeisters Manfred Jäzosch
und seiner Ehefrau Jutta Jäzosch, geborene Thiele. Großvater war der Kuschkower Schmied und spätere
Müllermeister Bernhard Jäzosch. Ziel der Website ist es, möglichst viele der noch existierenden
Dokumente, Fotos und Berichte mit ortsgeschichtlichem Bezug zu Kuschkow der Öffentlichkeit
vorzustellen. Die Website versteht sich als persönliche Familien- und Heimatseite und gleichzeitig
als sachliches Informationsangebot und digitales Archiv zur Dorfgeschichte. Die Bearbeitung der
Website mit allen Unterseiten erfolgt gemeinsam durch Doris und Norbert Rauscher.
Oben sehen Sie drei Bildausschnitte aus historischen Fotos, die vollständig mit
Hintergrundinformationen und Angaben zu den Bildquellen weiter unten gezeigt werden.
Die Inhalte dieser Website mit Unterseiten werden nach bestem Wissen regelmäßig
aktualisiert und erweitert, je nach zur Verfügung stehenden Dokumenten und Erkenntnissen.
Anregungen, Korrekturen und sonstige Hinweise werden gern entgegengenommen und
eingearbeitet, Kontaktdaten siehe ganz unten.
Hinweis: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert für
Desktop-PC und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort
kommt es leider zu Fehldarstellungen.
Seitenübersicht
► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten
► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch
► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435
► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit
► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955
► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959
► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow
► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute
► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687
► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842
► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine
► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945
► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960
► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965
► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960
► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden
► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
►
Historische Ortsansichten ‒ Teil 2
‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
Jutta Jäzosch, geborene Thiele, und ihre
Familiengeschichte
Diese Seite ist meiner Familie mütterlicherseits gewidmet. Ihre Familiengeschichte
begann in der brandenburgischen Neumark östlich der Oder, wurde durch Krieg und
Vertreibung aus der Heimat erschüttert und fand nach mehreren durch Kriegsereignisse
und Flucht geprägten Jahren ihre Fortsetzung und ihr Ende in der brandenburgischen
Niederlausitz bzw. bei Beeskow westlich der Oder. Weil die durch politische und
militärische Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg stark geprägte Familiengeschichte
nur verständlich wird vor diesem Hintergrund, sind einige über die unmittelbare
Familiengeschichte hinausgehende Informationen beigefügt, sie wurden jeweils
durch links vorgesetzte grüne Farbstreifen besonders gekennzeichnet. Diese Angaben
sind zu großen Teilen Wikipedia entnommen (siehe z.B. direkt hier:
►), sie werden hier auf der Kuschkow-Webseite sinngemäß zitiert.
Weitere Angaben findet man z.B. bei CompGen (siehe direkt hier:
►).
Allgemeine Literaturangaben zum Thema der Webseite gibt es ganz unten.
Das Dorf Kay
Meine Mutter Jutta Jäzosch wurde am 14. Januar 1929 im Dorf Kay als
Jutta Thiele geboren. Die Familie Thiele / Klenke lebte seit einigen
Generationen bis 1945 in Kay und Nachbarorten. Damals gehörte Kay in
der ostbrandenburgischen Neumark zum Kreis Züllichau-Schwiebus im östlichen
Gebiet des Preußischen Regierungsbezirks Frankfurt an der Oder. Der Kreis
Züllichau-Schwiebus war mit den preußischen Verwaltungsreformen 1816
in der Provinz Brandenburg gebildet worden aus den bis dato eigenständigen
Landkreisen Züllichau und Schwiebus, Kay gehörte zum Alt-Landkreis Züllichau.
Zusammen mit den anderen brandenburgischen Landkreisen östlich von Oder und
Neiße wurde das Gebiet 1945 unter polnische Verwaltung gestellt, 1950 dem
polnischen Staat durch bilaterale Verträge einverleibt und 1990 auch
völkerrechtlich als polnisches Staatsgebiet festgeschrieben.
Kay (heute polnisch: Kije) befindet sich in der ehemals brandenburgischen
Neumark 8 km westlich von Züllichau und 18 km südlich von Schwiebus. Die
einzige geschichtliche Erwähnung des Dorfes findet man im Zusammenhang mit
der Schlacht bei Kay zwischen Preußen und Russland im 7-jährigen Krieg am
23.7.1759. Friedrich der Große verlor diese Schlacht wie auch die Schlacht
im nahen Kunersdorf am 11.8.1759.
.jpg)
.jpg)
Zwei Ansichtspostkarten aus Kay und Umgebung
mit Fotografien aus der Vorkriegszeit. Die linke Karte ist bezeichnet mit "Gruss
aus Kay Kr. Züllichau-Schwiebus", mit vier Einzelansichten:
Kolonialwarenhandlung Fr. Thiele, Bahnhof, Partie am Fließ,
Kirche. Die rechte Karte zeigt das "Denkmal für die in der
Schlacht bei Kay-Palzig (1759) gefallenen Krieger. Errichtet
vom Kreis-Krieger-Verband Züllichau-Schwiebus". In beiden Fällen handelt
es sich um abfotografierte Postkarten, die für die Wiedergabe hier auf
der Webseite wiederum abfotografiert wurden ‒ daher die schlechte
Bildqualität.
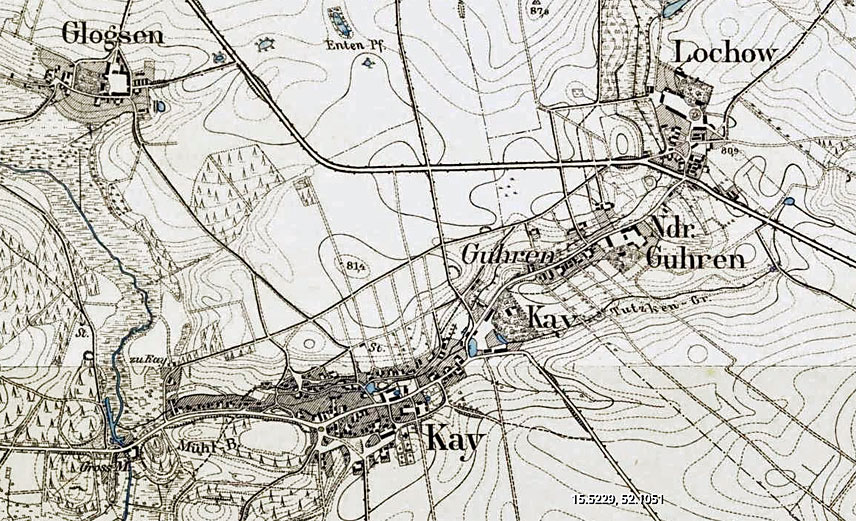
Ortslage Kay mit Guhren, Lochow und Glogsen um 1901.
Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische Karte 1:25000, Montage
Messtischblätter, Königlich Preußische Landes-Aufnahme 1901, herausgegeben 1903,
Auflagendruck 1918.
© Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de).
Die Eisenbahntrasse mit Bahnhof existierte offenbar noch nicht zum Zeitpunkt der
Kartenerstellung. Wenn Sie einen etwas größeren Bildausschnitt sehen möchten, dann
klicken Sie hier:
►
Vor 1945 war Kay ein Gutsdorf. Der Gutsbezirk Kay wurde 1928 formell
aufgelöst und in die Landgemeinde Kay eingegliedert. 1939 wurden die
Nachbardörfer Guhren und Lochow nach Kay eingemeindet. Die noch existierenden
Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus berichten, dass Kay vor
1945 über Bahnhof, Landkraftpoststelle, Schule, Gasthof mit Fleischerei,
einen Kolonialwarenladen sowie eine Großmühle verfügte. Seine evangelische
Kirche bildete ein eigenes Kirchspiel. Daneben gab es auch eine katholische
Kirche. In der "Geschichte der Stadt ... Züllichau" von 1927
(siehe Literaturverzeichnis unten) gibt es zu Kay auf Seite 106 folgende
Angaben: "Kay, 590 Einwohner. Schlacht bei Kay-Palzig. Kay mit
Niederguhren 1120 Hektar groß. Neuere Kirche. Die Großmühle mit der
Schanze. Kay gehörte seit Mitte des 16. Jahrhunderts den v. Gersdorfs.
Streit mit dem Müller Arnold unter Friedrich dem Großen. Jetziger
Besitzer: v. Wentzel."
Der erwähnte Streit mit dem Müller Arnold unter Friedrich dem Großen
steht nur indirekt in Verbindung mit Kay. Der damalige Landrat und Eigentümer
des Gutes in Kay, Georg Samuel Wilhelm Baron von Gersdorff (auch: Gersdorf),
hatte zwar 1770 durch Anlage eines Karpfenteichs auf seinem Gebiet dem
Wassermühlenbesitzer Johann Arnold (angeblich) das Wasser und damit die
wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen, das Streitobjekt, die Krebsmühle
am Eichmühlenfließ, lag aber südlich unterhalb von Kay in der Gemarkung
Pommerzig kurz vor der Einmündung in die Oder. Der Rechtsstreit wurde erst
1779 beendet durch direkte Weisung (Ordre) Friedrichs II., er ist als
"Arnoldscher Prozess" oder "Müller-Arnold-Fall" in
die Rechtsgeschichte eingegangen und wurde vielfach als Beispiel für
königliche Kabinettsjustiz und unvollkommene staatliche Gewaltenteilung
kommentiert. Eine ausführliche Darstellung der damaligen Aktenlage findet
man bei Christian Wilhelm von Dohm 1814 (siehe Literaturverzeichnis).
Verschiedene Publikationen (siehe Literaturverzeichnis) geben Auskunft
über die Einwohnerzahlen des Dorfes in den Jahren
1840 - 382 Einwohner (78 Wohngebäude incl. Rittergut)
1864 - 647 Einwohner (Gemeinde 78 Wohngebäude + Gutsbezirk 11 Wohngebäude)
1895 - 601 Einwohner (Gemeinde 505 + Gutsbezirk 96)
1905 - 552 Einwohner (Gemeinde 428 + Gutsbezirk 124)
1919 - 600 Einwohner (Gemeinde 428 + Gutsbezirk 172)
1925 - 585 Einwohner (Gemeinde 517 + Gutsbezirk 72)
1928 - 585 Einwohner (Gutsbezirk eingegliedert)
1931 - 577 Einwohner
1934 - 546 Einwohner
1937 - 536 Einwohner
1939 - 995 Einwohner (Eingemeindung von Guhren und Lochow)
1941 - 1030 Einwohner
.jpg)
Ansichtspostkarte "Gruss aus Kay" aus der Zeit
um 1915 mit vier kolorierten Schwarz-Weiß-Fotografien.
Abgebildet sind: Bahnhof, Gasthof und Fleischerei Sommer, Schule, Kirche
und Denkmal.
1945 wurde Kay, wie die anderen ehemals deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße,
von Stalin unter polnische Verwaltung gestellt. Seitdem trägt Kay den polnischen Namen
"Kije". Sowjetische und polnische Soldaten sowie polnische
Zivilisten vertrieben die deutschen Einwohner nach dem Krieg
aus diesen Gebieten. Im Hitler-Stalin-Pakt von 1939 beanspruchte die Sowjetunion das
Territorium der polnischen Ostgebiete an der sowjetischen Grenze. Stalin verwirklichte
die Einnahme der im Hitler-Stalin-Pakt festgelegten polnischen Ostgebiete, nachdem Polen
bis zur Oder-Neiße erobert war. Als Ausgleich erhielt Polen das ehemals deutsche Gebiet
östlich von Oder und Neiße. Polen erlebte damit eine West-Verschiebung. In den
betreffenden Gebieten führte man jeweils ethnische Säuberungen durch. Die Deutschen
wurden nur mit dem Nötigsten im Gepäck über Oder und Neiße in den Westen abgedrängt.
Wiederum vertriebene polnische Menschen aus den damaligen polnischen Ostgebieten
siedelte man in den freigewordenen ehemals deutschen Dörfern und Städten an. Sie
bezogen dort die Häuser der deutschen Eigentümer, so auch in Kay das Elternhaus
meiner Mutter.
Die Familien Thiele / Klenke
Heinrich Hermann Thiele aus Kay (8.5.1902 in Glogsen,
Neumark - 27.5.1979 in Schneeberg bei Beeskow)
Dorothea Grethe Frieda Klenke aus Kay (24.8.1902 in Kay,
Neumark - 14.11.1977 in Schneeberg bei Beeskow)
Heirat am 23.8.1928 in Kay. Alle Nachkommen in Kay geboren:
- Marta Lina Jutta Thiele (14.1.1929 - 17.2.2011 in Kuschkow)
- Frieda Hanna Christa Thiele ( 20.2.1930 - 9.6.1947 in Halle als Hausangestellte)
- Ida Emma Margot Thiele (25.3.1931 - ..?.. in Schneeberg)
- Harald Thiele (19.7.1932 - 28.6.1933 in Kay)
- Hermann Reinhold Siegfried Thiele (17.12.1935 - 30.4.1979 Viernheim)
- Dorothea Berta Ida Thiele (geboren 21.6.1938)
Eltern von Frieda Klenke:
August Klenke, Gastwirt und Kaufmann (21.2.1860 in Lochow - 25.11.1909 in Kay)
Ida Greulich (21.4.1865 in Kay - 11.2.1930 in Züllichau).
Heirat 1889. Nachkommen:
- Dorothea Grete Frieda (24.8.1902 in Kay - 14.11.1977 in Schneeberg)
- Marta (2.5.1904 in Kay - ..?.. in Schneeberg).
.jpg) Links ist Marta Klenke in Schneeberg bei einer Feier zu
sehen, vermutlich in den 1960er Jahren im Wohnhaus der Familie Thiele.
Links ist Marta Klenke in Schneeberg bei einer Feier zu
sehen, vermutlich in den 1960er Jahren im Wohnhaus der Familie Thiele.
Marta war ledig und lebte bis zu ihrem Lebensende gemeinsam mit Familie Thiele.
Sicher war sie ihrer Schwester in schwierigen Zeiten eine große Hilfe und den
Kindern eine gute Tante. Als die Familie in Kuschkow und Gröditsch wohnte,
fand sie wie viele Flüchtlingsfrauen Arbeit bei der Firma Carmol in Gröditsch.
In Schneeberg wohnhaft arbeitete sie im Krankenhaus von Beeskow in der Küche.
Leider ist ihr Todestag, wahrscheinlich im Jahr 1971, vergessen.
Der Kaufmann August Klenke, Vater meiner Großmutter, baute auf seinem Grundstück
in Kay ein Wohnhaus für seine Familie mit Laden.
Großeltern von Frieda Klenke (väterlicher Seite):
Gottfried Klenke, Landwirt (24.9.1812 - 21.12.1862 in Lochow)
Luise Kockjoy (5.11.1821 - 11.11.1907 in Lochow)
Großeltern von Frieda Klenke (mütterlicher Seite):
Gottlieb Greulich, Brauer und Gastwirt (7.5.1823 - 22.6.1889 in Kay)
Berta Kärger (2.4.1836 - 12.5.1905 in Kay)
Eltern von Hermann Thiele:
Gustav Thiele, Landwirt (25.6.1877 in Glogsen - 1945)
Berta Gierke (24.6.1881 in Glogsen - 28.6.1918 an Grippe in Glogsen).
Heirat Januar 1902 in Glogsen. Nachkommen:
- Hermann (1902-1979)
- Emma (10.3.1904 - 12.6.1995). Heirat am 30.9.1938 mit Karl Zwarg (25.2.1894 in
Züllichau - 21.4.1961 in Guben,
- Polsterer in Lochow bei Züllichau), ohne Nachkommen.
Auf der Seite Hochzeiten Teil 1 sind die Lebensdaten von
- Emma Zwarg unter ihrem
Hochzeitsbild zu finden.
- Lina (..?.. - 1945). Sie
heiratete und hatte mit ihrem Ehemann einen Sohn. Lina wurde von den Russen brutal vergewaltigt,
- worauf sich die ganze Familie das Leben nahm.
.jpg)
Gustav Thiele und seine zweite Ehefrau ..?.. Thiele
(rechts im Bild), links die Tochter Lina mit Ehemann Karl und ihrem
Sohn Manfred in der Bildmitte. Eine Fotografie eventuell aus der Zeit um 1942
(?). Zum tragischen Schicksal dieser Familie schrieb Jutta Jäzosch in ihren Erinnerungen
an das Kriegsende (siehe weiter unten): "Viele Menschen, die die Grausamkeiten der
russischen Soldaten und der polnischen Miliz nicht mehr ertragen konnten, nahmen sich
selbst das Leben. So auch mein Großvater. Seine jüngste Tochter hatten die Russen
derartig ungeheuerlich zugerichtet, daß er keinen anderen Rat wußte. Er erhängte
sie, ihren 10jährigen Sohn, seine Frau und sich selbst." Sein Schwiegersohn
war zu dieser Zeit vermutlich Soldat, ob er aus dem Krieg zurückkehrte, ist
nicht bekannt.
Die Familie von Hermann Thiele lebte gemeinsam mit Marta Klenke, der
Schwester von Frieda Thiele, im Elternhaus von Frieda Thiele, welches von ihrem Vater
August Klenke, Gastwirt und Kaufmann, um 1890 erbaut wurde. August Klenke führte als
Gastwirt das Gasthaus seines Großvaters mütterlicherseits, Gottlieb Greulich, Brauer
und Gastwirt, in Kay. Er erwarb um 1888 ein bis dahin unbebautes Eckgrundstück in
Kay (heute: S³oneczna 52), auf dem er das neue Haus mit Laden für seine Familie
erbauen ließ.
.jpg)
.jpg)
Das Wohn- und Geschäftshaus Thiele / Klenke in Kay.
Links eine Aufnahme wohl um oder kurz nach 1945,
jedenfalls nach Vertreibung der Familie, die alten Beschriftungen
der Familie Thiele (siehe folgendes Foto unten) sind bereits
entfernt, offenbar wurde es zu dieser Zeit durch polnische oder
sowjetische Behörden / Institutionen genutzt, alle Fensteröffnungen im
Erdgeschoss wurden vergittert. Rechts das Haus im renovierten Zustand
um 1995, fotografiert bei einem Besuch mit freundlichem
Empfang durch die polnischen Bewohner und neuen Eigentümer.
Die Tochter Frieda von August Klenke
übernahm später Haus und Laden, seine ledige Tochter Marta hatte
Wohnrecht im Haus. 1928 heirateten Frieda Klenke und Hermann Thiele.
Sie lebten im Klenke-Haus gemeinsam mit Marta Klenke. Bis zum Krieg hatten
Frieda und Hermann Thiele dort ein arbeitsreiches aber gutes Leben. Mutter
Frieda Thiele betrieb den Kolonialwarenladen und wurde dort nebenbei immer
bestens über alles Geschehen im Dorf informiert ‒ vor allem vom
befreundeten Pfarrer und Lehrer bei Fehlverhalten ihrer Kinder, was diese
eigentlich geheim halten wollten. In solchen Fällen wurde das getadelte
Kind sofort herbeizitiert und vor Pfarrer oder Lehrer bestraft. Mit seinem
Pferd und Wagen beschaffte Vater Hermann Thiele die Waren für den Laden.
Im Garten gab es einen Teich, in dem Fische für den Verkauf gehalten wurden.
.jpg) Jutta
Thiele (rechts außen) mit zwei Freundinnen um 1943
auf der Eingangstreppe ihres Elternhauses in Kay. Das Foto ist leider
sehr stark beschädigt. Über der Eingangstür zum Laden ist zu lesen
"Kolonialwaren Hermann Thiele", außerdem kann man rechts
erkennen, dass auch Kurzwaren angeboten wurden. In den großen
Gewerbeverzeichnissen des Deutschen Reichs von 1935, 1938 und 1939 waren
jedoch nicht Hermann Thiele sondern immer Mutter bzw. Tochter Klenke als
Inhaberinnen (oder nur Betreiberinnen ?) eines "Gemischtwaren"-Geschäfts
verzeichnet, siehe dazu unten im Literaturverzeichnis die Angaben bei
"Klockhaus" 1935 und "Deutsches Reichs-Adressbuch" 1938.
Jutta
Thiele (rechts außen) mit zwei Freundinnen um 1943
auf der Eingangstreppe ihres Elternhauses in Kay. Das Foto ist leider
sehr stark beschädigt. Über der Eingangstür zum Laden ist zu lesen
"Kolonialwaren Hermann Thiele", außerdem kann man rechts
erkennen, dass auch Kurzwaren angeboten wurden. In den großen
Gewerbeverzeichnissen des Deutschen Reichs von 1935, 1938 und 1939 waren
jedoch nicht Hermann Thiele sondern immer Mutter bzw. Tochter Klenke als
Inhaberinnen (oder nur Betreiberinnen ?) eines "Gemischtwaren"-Geschäfts
verzeichnet, siehe dazu unten im Literaturverzeichnis die Angaben bei
"Klockhaus" 1935 und "Deutsches Reichs-Adressbuch" 1938.
Hermann Thiele war außerdem ein offenbar leidenschaftlicher
Musiker. Er spielte in einer Kapelle alle Blasinstrumente.
Auf dem folgenden Foto ist er auch am Kontrabass zu sehen. Er pflegte
Hausmusik mit seinen Töchtern Jutta am Akkordeon und Christa mit Violine.
Siegfried erhielt bereits als kleiner Junge Klavierunterricht. Auch an
seinem letzten Wohnort Schneeberg spielte er in einer Kapelle.
.jpg)
.jpg) Jutta Jäzosch, meine Mutter,
wurde am 14. Januar 1929 im Dorf Kay als Jutta Thiele geboren; links ist
sie als Baby auf einer Felldecke im Garten zu sehen. Sie war die
älteste Tochter von Frieda und Hermann Thiele. Nach ihr folgten ihre
Geschwister Christa 1930, Margot 1931, Siegfried 1935 und Dorothea
(Thea) 1938. Alle Kinder besuchten die Schule in Kay, wo sie eingeschult
wurden. Nur die älteren Geschwister empfingen die Konfirmation noch in
Kay. Frieda und Hermann Thiele sorgten für eine schöne, behütete
Kindheit ihres Nachwuchses.
Jutta Jäzosch, meine Mutter,
wurde am 14. Januar 1929 im Dorf Kay als Jutta Thiele geboren; links ist
sie als Baby auf einer Felldecke im Garten zu sehen. Sie war die
älteste Tochter von Frieda und Hermann Thiele. Nach ihr folgten ihre
Geschwister Christa 1930, Margot 1931, Siegfried 1935 und Dorothea
(Thea) 1938. Alle Kinder besuchten die Schule in Kay, wo sie eingeschult
wurden. Nur die älteren Geschwister empfingen die Konfirmation noch in
Kay. Frieda und Hermann Thiele sorgten für eine schöne, behütete
Kindheit ihres Nachwuchses.
Das folgende Schulbild mit Christa (stehend außen links
in der ersten Reihe) und Jutta (zweite Reihe links
außen) dürfte um 1936 entstanden sein, erstes und/oder
(?) zweites Schuljahr, Jutta war also etwa sieben Jahre alt. Die
Lehrerin hieß Gloatz (gemäß Heimatkalendern des Kreises
Züllichau-Schwiebus von 1936 und 1937). Der Pfarrer hieß Messow.
.jpg)
Die folgenden vier Schulbilder dürften im Zeitraum zwischen 1939 und 1941
entstanden sein. Unklar bleibt auch bei diesen Bildern, ob es sich jeweils um
Schüler nur eines Jahrgangs handelt oder ob hier wie in Kuschkow mehrere
Jahrgänge in einer Klasse unterrichtet wurden. Dem äußeren Anschein nach
waren alle Kinder etwa gleich alt, also vom selben Jahrgang. Die
Schwestern Jutta und Christa Thiele gehörten jedoch nicht demselben
Geburtsjahrgang an, wurden aber eventuell gemeinsam eingeschult (?). Dem
Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus von 1939 kann man
entnehmen, dass zu dieser Zeit die folgenden Lehrer an der Schule in Kay
tätig waren: Hauptlehrer Bunk, Lehrer Lenius, Lehrerin Gloatz. Der
Pfarrer hieß Messow.
.jpg)
Schulbild mit Jutta (drittes Mädchen von rechts in der
zweiten Reihe) und Christa (ganz vorn fünftes Mädchen
von rechts im karierten Kleid) um 1939. In der zweiten
Reihe an dritter Stelle von links steht der Lehrer mit Brille.
.jpg)
Schulbild mit Jutta (achtes Mädchen von links) und
Christa (viertes Mädchen von links) um 1939,
vielleicht ein Badeausflug in den Sommerferien.
.jpg)
Schulbild mit Jutta (dritte von links sitzend),
Margot (zweite von links sitzend) und
Christa (erste von links sitzend)
um 1939. Kaum erkennbar in der zweiten Reihe
als fünfte Person von rechts steht wieder der Lehrer mit Brille.
.jpg)
Schulbild mit Jutta (sechstes Mädchen von links in der
vorderen Reihe), Margot (rechts neben Jutta, siebentes
Mädchen von links) und Christa (könnte das vierte Mädchen
von links in dieser Reihe sein) um 1939-1941. Auf diesem
Foto ist eine Lehrerin zu sehen (kaum erkennbar als fünfte Person von
links), was darauf hindeutet, dass der Lehrer bereits zum Kriegsdienst
eingezogen war.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges kehrte sich ihr bisher gutes Leben ins
Gegenteil. Der Vater musste an die Ostfront. Frieda Thiele hatte nur noch
die Unterstützung von Ihrer Schwester Marta und den älteren Kindern. In
der Schule hatten die Kinder aber wohl auch zu dieser Zeit noch ein
vergleichsweise unbeschwertes Leben ‒ wie die Bilder oben Zeigen.
|
Geschichtliche Hintergründe ‒
Ursachen und Wirkungen |
Besetzung von Kay und Vertreibung
Am 29. Januar 1945 besetzte die Rote Armee Kay. Während andere ostdeutsche
Gebiete am 28. Januar 1945 den Befehl zur Räumung erhielten, untersagte
der Leiter des NSDAP-Gaus noch am Vortag den Einwohnern des frontnahen
Landkreises Züllichau-Schwiebus eine Flucht. Zeugen berichten, dass
Deutsche, die auf eigene Faust flüchteten, von den Nazis zurückgetrieben
oder im schlimmsten Fall sogar getötet wurden.
Als Kriegsverlierer vertrieb die Rote Armee nach Besetzung die östlich
von Oder und Neiße lebenden Deutschen aus ihren Häusern, Dörfern und
Städten. In Kay waren bereits Flüchtlinge aus anderen Gebieten untergebracht.
Unter der Gewalt von Rotarmisten mussten Frieda Thiele und ihre Schwester
Marta Klenke das Allernötigste packen und mit den fünf Kindern ihr Haus
verlassen. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern aus Kay trieb man sie
in Richtung des 19 Kilometer entfernten Schwiebus.
Vergewaltigungen, Mord, Misshandlungen und Demütigungen standen von
nun an auf der Tagesordnung. Alle Straßen waren von Flüchtlingstrecks
verstopft. Sie kamen ‒ wenn überhaupt ‒ nur langsam voran. Nach drei
Tagen fand der Marsch für die Bewohner aus Kay in dem bereits
geplünderten Merzdorf östlich von Schwiebus vorerst sein Ende,
wo sie mit Bewohnern anderer deutscher Dörfer vorübergehend bleiben
durften. Ungefähr am 18. Februar 1945, nach 20 Tagen, trieben sie
die Rotarmisten zurück in ihr inzwischen geplündertes Heimatdorf
Kay. Dort angekommen, zogen die Dorfbewohner dicht zusammen in
wenige kleine Häuser. Sie fanden die eigenen Häuser unbewohnbar
vor, völlig verdreckt. Alles Verwertbare wie Fenster, Türen und
Inneneinrichtungen waren gestohlen, nicht Interessantes war
zerstört, Essenvorräte in den Häusern vernichtet. Unter Bewachung
sowjetischer Posten liefen die Deutschen Bewohner täglich zu der
ihnen angewiesenen Arbeit und am Abend wieder zurück nach Kay.
Im nahe gelegenen Palzig hatte die G.P.U. (sowjetischer Geheimdienst)
ihren Sitz genommen. Sie suchte in den umliegenden Orten Deutsche
für den Transport nach Sibirien. Zuerst waren die Jungen ab 16 Jahren
an der Reihe, dann, es könnte Anfang März 1945 gewesen sein, die
Mädchen und Frauen ab 16 Jahren. Meine Mutter Jutta Thiele war mit
anderen Mädchen gerade bei der Feldarbeit, als sie direkt vom Feld
abgeholt wurden.
|
Von sowjetischer Seite erging am 18. April 1945 der entscheidende
Befehl Nr. 00315 zur Errichtung von Lagern mit
dem Ziel der "Säuberung des Hinterlandes der kämpfenden
Truppen der Roten Armee von feindlichen Elementen". Dieser
Befehl war bis 1950 die Grundlage für alle Internierungen in
der sowjetischen Besatzungszone und in der späteren DDR. Der
Befehl diente der Sowjetunion als Grundlage, das in Jalta
vereinbarte Kriegsziel der "Vernichtung des deutschen
Militarismus und Nazismus" zu erreichen. In Anlehnung
an die alliierten Vereinbarungen wird unter Punkt 1 des
NKWD-Befehls der Kreis von Personen definiert, der in
eigens dafür einzurichtenden Gefängnissen und Lagern
"an Ort und Stelle", d.h. in der sowjetisch
besetzten Zone Deutschlands, zu internieren sei. |
Verschleppung, Gefangenschaft und
Zwangsarbeit
Damit begann für Jutta Thiele (1929-2011) fern von der Familie und
von zu Hause eine vier Jahre dauernde Gefangenschaft an verschiedenen
Orten. Sie und andere Mädchen und Frauen wurden in Lagern, Gefängnissen,
Zuchthäusern und KZ’s eingesperrt. Man ließ sie für die Verbrechen
der Deutschen büßen. Es ging für sie alle um das nackte Überleben trotz
Gewalt, Vergewaltigung, Krankheiten, Demütigungen und Hunger. Es blieben
ihnen nur wenige Kleidungsstücke, die sie am Leib hatten ‒ die
Schuhe wurden ihnen genommen. Als Ausgleich bekamen sie Lumpen und
alte kaputte Galoschen. Man schnitt ihnen die Haare ab und rasierte
ihre Köpfe kahl.
Ein Erlebnisbericht meiner Mutter über die Zeit nach dem 29. Januar
1945 beschreibt dieses sowie weitere persönliche Erlebnisse. Er
erschien 1995 in einer Broschüre mit Auszügen aus Tagebüchern,
Briefen und Aufzeichnungen, die von Lothar Meißner im Auftrag des
Heimatkreises Züllichau-Schwiebus herausgegeben wurde unter dem
Titel "Vor 50 Jahren: Als Flucht und Vertreibung im Kreis
Züllichau-Schwiebus begannen" (siehe Literaturverzeichnis unten).
Die folgenden Bilder zeigen diesen Bericht auf den Seiten 96-100 als Textauszug aus der
Publikation (klicken Sie auf diese Bilder, dann sehen Sie jeweils eine
gut lesbare Vergrößerung). Oder klicken Sie direkt
hier:
► ‒ dann sehen Sie den
kompletten Erlebnisbericht als PDF.





In derselben
Veröffentlichung erschien ein Erlebnisbericht von Dr. S. von
Sievers über das Gefangenenlager in Schwiebus, welches als
Sammellager zur Bildung der Transporte nach Russland genutzt
wurde. Dort musste meine Mutter gemeinsam mit anderen Mädchen
und Frauen warten, bis ihr Deportationszug nach Sibirien komplett
zusammengestellt war. In Viehwaggons verladen ging der Zug ab
nach Sibirien. Nahe Warschau nahmen Polnischen Partisanen den
Zug unter Beschuss. Sie erzwangen dadurch die Umkehr des Zuges
mit dem neuem Ziel Posen. Gefangene in diesem Transport waren
von da an polnische Gefangene ‒ ein Transport nach
Sibirien fand für meine Mutter und vermutlich auch für die
anderen Menschen aus diesem Zug nicht mehr statt. Wer mehr
über Werdegang und Widrigkeiten wissen möchte, lese bitte
den bereits erwähnten persönlichen Bericht meiner Mutter.
|
Ab März 1945 waren von der polnischen Regierung in Absprache
mit der Sowjetunion deutsche Siedlungsgebiete östlich der Oder-Neiße-Linie
polonisiert worden. Sie waren administrativ in den polnischen Staatsverband
eingegliedert und sämtliche Ortschaften wurden umbenannt. Weitere Informationen
dazu findet man bei Wikipedia (siehe direkt hier:
►). |
Leider konnte das genaue Datum der endgültigen Vertreibung der
Bewohner aus Kay mit Frieda Thiele, Schwester Marta Klenke und
den verbliebenen vier Kindern nicht genau ermittelt werden,
wahrscheinlich geschah es in der Zeit vom 25.6. bis 1.7.1945.
Damit haben sowohl Stalin als auch Polen vor der Potsdamer
Konferenz Tatsachen geschaffen. Die Vertreibung der Deutschen
aus Züllichau wird mit dem 1.7.1945 angegeben. Erlebnisberichte
aus Nachbarorten von Kay geben den 25. und 30.6.1945 für die
Vertreibung an.
Nach dem Krieg ‒ Ankunft in Kuschkow
Als einzige Dorfbewohner von Kay wurden Thieles nach Kuschkow
zwangsumgesiedelt. Es wird noch ermittelt, nach welchem System die
Vertriebenen in Deutschland verteilt wurden. Frieda Thiele, Schwester
Marta Klenke und die vier Kinder mussten mit dem Zug bis nach Cottbus
fahren und von dort weiter nach Lübben. In Lübben wurden sie durch
Pferdewagen abgeholt. Man brachte sie nach Kuschkow direkt in ihre
Unterkunft im Fachwerkhaus bei Köllnicks in der Dorfstraße 16. Angekommen
in Lumpen kann man vielleicht nachvollziehen, dass sie unfreundlich
im Dorf aufgenommen wurden. "Kleider machen Leute". Alles,
was sie besaßen, nahmen ihnen Russen und Polen vorher ab. Lumpen
dienten als Ersatz.
.jpg)
Bauern mit Pferdegespann auf der Kuschkower Dorfstraße
in den frühen 1950er Jahren vor dem Fachwerkhaus Nr. 16,
in dem die Familie Thiele als Flüchtlinge einige Räume zugewiesen bekam.
Rechts neben seinem Pferdegespann steht Hermann Thiele
im dunklen Mantel, wie immer mit Tabakspfeife.
|
Potsdamer Konferenz der "Großen Drei" (17.7. - 2.8.1945): Harry S. Truman, Winston S. Churchill bzw. ab 28. Juli Clement R. Attlee und Josef W. Stalin. Das sogenannte "Potsdamer Abkommen" regelte die künftige Politik der Alliierten für das Deutsche Reich (Neufestlegung der Grenzen, Teilung in Zonen der jeweiligen Alliierten, Reparationen). Am folgeschwersten gilt die Legitimierung der Vertreibung der Deutschen aus Polen, Tschechoslowakei und Ungarn, sowie die Verwaltungshoheit Polens über die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße. Schon vor der Entscheidung der Alliierten über eine vorläufige Nachkriegsordnung im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 unterstellte die Sowjetunion das deutsche Gebiet östlich der Oder und der Lausitzer Neiße (mit Ausnahme des Königsberger Gebiets) den Verwaltungsorganen der Republik Polen. Das Deutsche Rote Kreuz richtet am 18.10.1945 einen Suchdienst zur Auffindung vermisster Personen ein. |
Wahrscheinlich erfuhr Mutter Thiele 1947 vom Aufenthaltsort ihrer
Tochter Jutta über das Rote Kreuz. Es existieren nur aus diesem Jahr
Briefe von Jutta. Diese Briefe beklagen nicht die Zustände im Lager
(aus Sicherheitsgründen) ‒ nur die Wehmut von Familie und Heimat
getrennt zu sein und den Tod ihrer Schwester. In einem Brief aus dem
Jahr 1948 an die ehemalige Mühlenbesitzerin von Kay, Frau Legott,
erwähnt Frieda Thiele, dass sie Briefe ihres Ehemanns aus der
Gefangenschaft empfing, aber aktuell keine Nachricht mehr von ihm bekam,
daher weder über seinen Aufenthaltsort noch sein Befinden etwas wusste.
Dieser Brief meiner Großmutter Frieda Thiele, den sie am
29.2.1948 an ihrem neuen Wohnort Kuschkow verfasst hat und der
ihre persönliche Situation schildert, ist erhalten. Der Inhalt
wird im Folgenden auszugsweise wiedergegeben, zur Vergrößerung
die Bilder bitte anklicken, nach den Bildern folgt die Transkription:
.jpg)
.jpg)
Kuschkow, 29.II.48
Meine liebe Frau Legott ... Habe jetzt so oft Briefe angefangen, aber bin
es kaum imstande, welche fertig zu bringen. Es packt mich dann Wehmut und
Bangigkeit und bin dann nicht Herr meiner Kräfte, dann muß ich so weinen
und bringe nicht einen Brief fertig. ... wo ist und bleibt unsere liebe,
alte Heimat? Werden wir nochmal dorthin kommen? Ach, was war es doch dort
schön, wenn man es auch schwer hatte, aber Heimat bleibt Heimat. ...
unsere arme liebe Jutta ist noch weg. Die muß ordentlich lange aushalten.
Was muß das Mädel durchmachen. ... Nein, soviel durchzumachen ist nicht
leicht. Hätte man das jemals geahnt oder geglaubt. Wie sind wir doch
so zerstreut. Von unserm Vater haben wir seid Juli keine Post mehr. Er
ist noch in Rußland. Wo er steckt, weiß man nicht. Warten so sehnsüchtig
auf ihn. Was wird er für Schreck kriegen, wenn er erst mal wird alles
erfahren. Und hier, im Spreewald, bleibt viel zu wünschen übrig. Die
Leute so stur und nur das eigene ich. Für Flüchtlinge kein Verständnis,
na es nützt alles nichts, wir müssen tragen, was uns der liebe Gott
auferlegt hat. Wollen doch hoffen, daß es nochmals etwas besser wird.
Wenn bloß erst Jutta und Vater hier wärn. ... Vater in Rußland, Jutta in
Polen, Christel in Halle und mit den Kleinen muß ich nun hier hausen.
Die beiden Kleinen gehen zum Bauern und verdienen sich ihr Stückchen
Brot dazu. Thean muß schon feste mit helfen, ach tut mir das in der
Seele weh. Und Sigi auch. ... werden wir nochmal heimkommen? ...
Monatlich bekomme ich 20 Mark davon Leben. Wir müssen alle Tage jetzt
Holzmachen. Tante Marta ist beim Bauern in der Selbstversorgung und
bekommt 30-40 Mark. Ja, so müssen wir hausen. ... Nun, liebste Frau
Legott, würde ich mich aber so sehr freuen von Ihnen ein paar Zeilen zu
erhalten, denn die Post ist noch unsre einzigste Freude. ... (hier
endet die Transkription des Briefes.)
Ende 1948 wurde Hermann Thiele sehr krank aus der russischen
Gefangenschaft entlassen. Aber er lebte. Er fand seine Familie
unvollständig in Kuschkow vor. Seine Frau Frieda konnte ihm wegen
unbekannter Adresse nicht über den Tod seiner Tochter Christa
berichten. Diese Nachricht überraschte ihn in Kuschkow.
Jutta kommt 1949 nach Kuschkow zur Familie:
Nach schwerer Erkrankung schickte man Jutta völlig geschwächt im Oktober
1948 auf das Gut Bielice zur Arbeit in der Schnapsbrennerei. Dort erfuhr
sie von der Möglichkeit, dass ihre Familie sie über das Rote Kreuz anfordern
könne. Ein freundlicher polnischer Familienvater mit dem sie in der Brennerei
arbeitete, besorgte ihr Briefpapier. Heimlich wurde ihr Brief mit dieser
Information an ihre Mutter aus dem Lager geschmuggelt und aufgegeben.
Nachdem sie im Januar die polnische Staatsbürgerschaft ablehnte, wurde
Jutta wahrscheinlich im Frühjahr 1949 freigelassen. Nach einer langen
ungewissen Zugfahrt mit vielen Quarantäneaufenthalten kam sie schließlich
in Leipzig an. Dort wurde sie von ihrer Mutter nach vier Jahren
Trennung abgeholt. Erst der Hohn umherstehender Menschen machte Jutta
bewusst, welchen Anblick sie in Lumpen gehüllt und ungewaschen bot. Sie
waren wieder vereint, in dem Moment das Allerwichtigste ‒ ein
unbeschreiblicher Glücksmoment für die Familie trotz der misslichen
Lage in Kuschkow, freilich getrübt durch den Verlust von Christa.
.jpg)
.jpg) Jutta Thiele und Manfred Jäzosch
Jutta Thiele und Manfred Jäzosch
um 1951 in Kuschkow, zwei Fotos
wieder in glücklichen Tagen wohl
kurz vor ihrer Hochzeit.
Hochzeit in Kuschkow
Am 14. Januar 1952, dem 23. Geburtstag von Jutta Thiele, haben sie
und Manfred Jäzosch in Kuschkow geheiratet. Jutta und Manfred
Jäzosch lebten auf dem Hof von Manfreds Mutter Emma Jäzosch und betrieben
Mühle und Wirtschaft. Ihr Leben als Jutta Jäzosch ist nachzulesen auf der
Seite "Kuschkower Mühle". In der DDR untersagte man ihr,
öffentlich von ihrer Gefangenschaft zu berichten. Jedoch sprach sie mit
Menschen, denen sie vertrauen konnte darüber. Eine Bindung zu ihrer alten
Heimat hatte sie bis zum Lebensende. Ab 1. Januar 1972 wurde die Grenze
nach Polen für den individuellen visafreien Verkehr geöffnet. Von da an
konnte sie ihr Heimatdorf besuchen. Anfangs wurden sie misstrauisch beäugt
‒ die Eigentumsverhältnisse waren noch nicht endgültig zwischen
Deutschland und Polen geklärt, die Polen noch nicht Eigentümer der von
ihnen seit Kriegsende bewohnten Häuser und Grundstücke. Mit der
endgültigen Klärung im Jahr ???? wandelte sich das Verhalten der Polen.
Jutta war dankbar für die Freundlichkeit der polnischen Bewohner ihres
ehemaligen Elternhauses. Dort war sie immer willkommen. Erst nach der
"Wende" und der deutschen Wiedervereinigung 1989/1990, sie
war 60 Jahre alt, durfte sie frei über ihre Zeit im Lager sprechen und
konnte sich mit ihren damaligen Leidensgenossen treffen. Sie betrieb
erfolgreich ihre Rehabilitation und war sehr aktiv bei der öffentlichen
Aufarbeitung der Themen Gefangenschaft und Vertreibung, besuchte
Gedenkstätten in Polen. Gefangenschaft und Vertreibung ließen sie
dennoch bis zum Tod nicht los. Das folgende Foto zeigt die Mitglieder
beider Familien am Hochzeitstag:
.jpg)
.jpg)
Hochzeit Jutta Thiele + Manfred Jäzosch am
14.1.1952, von links nach rechts: Margot und Siegfried Thiele
(Schwester und Bruder der Braut), Emma Jäzosch (Mutter des Bräutigams),
das Brautpaar Jutta und Manfred Jäzosch, die Brauteltern Frieda und
Hermann Thiele sowie ganz rechts Dorothea Thiele (Schwester der Braut).
Weitere Informationen und Fotos zu dieser Hochzeit und den
Hochzeitsgästen gibt es auf der Mühlenseite.
Am 14.7.1953 erblickte ihre Tochter Doris das Licht der
Welt. Schon im Alter von drei Jahren erlernte sie auf dem Mühlenhof das
Reiten, wie man auf dem Foto links mit Mutter Jutta um 1956
sehen kann. Das Pferd Moritz, ein wuchtiger Kaltblüter-Hengst und
charakterstarkes Arbeitstier, war der ganze Stolz der Familie.
Familie Thiele findet eine endgültige Bleibe
Die restliche Familie Thiele zog erst 1954 von Kuschkow nach
Gröditsch in Hilberts Haus (aktuell Gröditscher Dorfstraße 8). Endlich wohnten sie in
einer menschenwürdigeren Unterkunft. Sie durften den großen Garten vor
dem Haus nutzen. Ich liebte als kleines Kind den schönen Garten, in dem
es eine Hängematte gab, und besuchte sie gern mit dem Roller. Im Haus
wohnte ebenfalls der katholische Pfarrer mit seiner Schwester. Mir
vorher unbekannt ‒ sie besaßen herrlich buntes Kinderspielzeug
(Lego) womit die Kinder bei Besuchen dort spielten durften.
.jpg) Hilberts
Hof in Gröditsch um 1956 mit Stall und Fachwerkscheune als
Wirtschaftsgebäude im Hintergrund (heute Gröditscher Dorfstraße 8),
vorn im Hausgarten steht etwas verunsichert die kleine Doris.
Hilberts
Hof in Gröditsch um 1956 mit Stall und Fachwerkscheune als
Wirtschaftsgebäude im Hintergrund (heute Gröditscher Dorfstraße 8),
vorn im Hausgarten steht etwas verunsichert die kleine Doris.
Hof Thiele in Schneeberg
Im Jahr 1957 erwarben Frieda und Hermann Thiele eine
Bauernwirtschaft im Dorf Schneeberg (Kreis Beeskow) mit
Wohnhaus, Scheune, Ställen, Schuppen und allem nötigen Gerät, darunter
landwirtschaftliche Maschinen bis hin zur Dreschmaschine, außerdem mit
Feldern und Wiesen sowie einem großem Hausgarten. Sie hielten viele
Kühe, Schweine und Hühner. Hermann Thiele besaß auch zwei Schimmel
als Arbeitstiere für seine Bauernwirtschaft, Biene und Benno, aus
eigener Zucht, links sind sie zu sehen. Ein anderes Fahrzeug als Pferd
und Wagen besaß er nie und erledigte nach Möglichkeit alles mit seinem
Pferdegespann. Er war froh, wieder auf eigene Rechnung wirtschaften zu können.
.jpg)
Nur wenige Jahre später endete die Zufriedenheit meines Großvaters
Thiele schlagartig mit der Zwangskollektivierung, zunächst in die
LPG Typ I und später dann Typ III. Mit LPG-Eintritt hatten alle
einen Inventarbeitrag von mindestens 500 Mark (DDR) pro Hektar
Land, 800 Mark (DDR) pro Hektar Wald zu zahlen. Im Typ I behielten
die Bauern noch einen gewissen privaten Anteil an Vieh, Feld und Wiese.
Später mit Übergang in den LPG-Typ III wurde der private Besitz von Vieh
auf eine Kuh und wenige Schweine sowie Feld- und Wiesenfläche stark
reduziert, die Inventarbeiträge hingegen deutlich erhöht. Thieles
hatten bestimmt noch den Kauf des Bauernhofes nicht abgezahlt,
dazu kam die Last der Inventarbeiträge. Ich kann mich sehr gut
daran erinnern, dass Hermann Thiele bei Besuchen meiner Familie
anlässlich von Familienfeiern in Schneeberg regelmäßig seinem Ärger
über dieses Thema Luft verschaffte.
Trotz LPG ließ sich Hermann Thiele seine beiden Schimmel nicht nehmen.
Wie damals von Kay aus fuhr er nun mit seiner Frau Frieda mit
Pferdegespann und Wagen auf dem Sommerweg von Schneeberg zum Einkaufen
nach Beeskow. Obwohl Hermann Thiele mehrfach Fußtritte von Benno
verpasst bekam, trennte er sich erst als er krank wurde im hohen Alter
von den beiden Schimmeln. Die Großeltern Thiele lebten bis zu ihrem Tod
(Frieda Thiele bis 1977, Hermann Thiele bis 1979) auf ihrem Bauernhof
in Schneeberg. Danach wurde der Hof von ihrer Tochter Margot weitergeführt
und später nach ihrem Tod von ihrem Ehemann verkauft.
Frieda Hanna Christa (20.2.1930
in Kay – 9.6.1947 in Halle als Hausangestellte). Wie schon beschrieben
kam Christa als Vertriebene mit Mutter und Geschwistern im Juni 1945 nach
Kuschkow. Wenig später beschaffte ihr Ihre Mutter eine Stelle als Hausangestellte
bei einem Arzt in Halle. Wahrscheinlich hatte sie sich eine TBC während der
Vertreibung zugezogen. In Halle brach die Krankheit so stark aus, dass sie
1947 daran verstarb. Seit der Trennung von Jutta im März 1945 haben sich
die beiden Schwestern nicht mehr wiedergesehen.
.jpg)
.jpg) Tochter Christa Thiele
und Mutter
Tochter Christa Thiele
und Mutter
Frieda Thiele
in zwei undatierten
Aufnahmen aus
unterschiedlichen
Zeiten. Christa wird wohl
auf diesem
Foto etwa 16 Jahre alt
gewesen sein.
Ida Emma Margot (25.3.1931
in Kay - ..?.. in Schneeberg): Nach der Vertreibung aus Kay in Kuschkow
angekommen, zog die Familie 1954 nach Gröditsch und schließlich 1957 nach
Schneeberg, Kreis Beeskow. Zunächst arbeitete Margot in der eigenen Wirtschaft
in Schneeberg und mit LPG-Eintritt in der LPG. Sie heiratete um 1976 und
lebte mit ihrem Ehemann Quenzel im Elternhaus in Schneeberg. In den 1980er
Jahren starb sie in Folge einer Grippeerkrankung.
Hermann Reinhold Siegfried
(17.12.1935 in Kay - 30.4.1979 in Viernheim): Er war der einzige Sohn und
deshalb liebstes Mitglied der Familie. Er wurde in seinem Heimatdorf
Kay eingeschult. Das Kriegsende mit Vertreibung von zu Hause brachte
einen alles erfassenden Bruch. Seinen Klavierunterricht konnte er
in Kuschkow bei Frau Luise Michelchen fortsetzen. 1950 wurde er
in Kuschkow konfirmiert. Er durfte ab dem 9. Schuljahr das Gymnasium
in Lübben besuchen. 1953 bestand er das Abitur. Die bitteren
Erfahrungen, mit denen er schon als Kind konfrontiert war, haben sicher
auch dazu beigetragen, dass er mit der Ideologie in der DDR auf Kriegsfuß
stand. Er ging nach Westberlin, wo er an der TU studierte. Gegenseitige
Familienbesuche waren bis zum Mauerbau noch möglich. Weihnachten und
Ostern verbrachte er manchmal bei seinen Eltern in Schneeberg, wo aus
diesem Anlass die Familie zusammenkam und fröhlich feierte. Später
beendete er sein Studium in Aachen als Diplomingenieur. Er heiratete am
31.3.1967. Nach weiterer Ausbildung arbeitete er als Patentassessor. Seine
Eltern durften ihn endlich als Rentner besuchen. 1977 kam er nach 16 Jahren
zur Beisetzung seiner Mutter wieder zu Besuch nach Schneeberg in die DDR.
Leider starb er plötzlich im Alter von 44 Jahren noch vor seinem Vater. Er
hinterließ seine Ehefrau und seine kleine Tochter. Der von ihm in Angriff genommene
Hausbau für seine Familie wurde geändert nach seinem Tod verwirklicht.
.jpg)
Konfirmation Palmarum 1950 in Kuschkow, Gruppenfoto vor
dem Eingang zur Dorfschule in der Kirchstraße. Unter der Girlande steht
rechts hinten als dritter Junge von rechts Siegfried Thiele.
Zu diesem Jahrgang gehörten noch die Konfirmanden Piater und Staude ganz
rechts, links von Siegfried Thiele folgen Günther Becker, Gustav und
Gerhard Städter, ..?.. Stelldinger, Gerhard Wilke, Wolfgang Wilke,
Wolfgang Kaiser, Hans-Herbert Dietrich, ..?.., ..?.., Dieter Krenz und
Günther Kühn. Die Mädchen sind von links Käthe Nutschel, Emmi Schrobback
(erste Reihe zweite von links), Sigrid Matschei, Rita Arnold, Käthe Leutloff
und Elfriede Kunze. (Foto: Familienarchiv Dorothea Witzke, geborene Thiele)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Links Thea Thiele zu ihrer Konfirmation 1953
in Kuschkow. In der Mitte Siegfried Thiele zur
Einschulung 1943 in Kay und rechts zur Konfirmation
1950 in Kuschkow (siehe dazu das Gruppenfoto oben vor dem
Schuleingang).
.jpg)
.jpg)
Familienfeier in Schneeberg um 1960.
Auf dem linken Bild sitzen vorn von links Mutter Frieda, Sohn Siegfried,
Tochter Jutta (verheiratete Jäzosch) und Vater Hermann Thiele, dahinter
links Dorothea (Thea) und die kleine Enkelin Doris, Tochter von Jutta.
Das rechte Bild zeigt Mutter Frieda mit Sohn Siegfried am Klavier.
.jpg) Siegfried
mit Freunden, vermutlich während der Abiturzeit um 1953
Siegfried
mit Freunden, vermutlich während der Abiturzeit um 1953
Dorothea (Thea) Berta Ida
(21.6.1938 in Kay): Sie wurde trotz der Wirrnisse zu Kriegsende noch in Kay
eingeschult. Nach der Vertreibung schulte man sie ein zweites Mal in Kuschkow
ein. Bis zu Ihrer Konfirmation besuchte sie die Kuschkower Schule. Nach dem
8. Schuljahr hatte sie gemeinsam mit Walli Borch Steno- und
Schreibmaschinenunterricht in Lübben, sie besuchten beide dort die
Berufsschule. Danach arbeitete sie in Frankfurt/Oder, Lübben und
Cottbus und lernte ihren späteren Ehemann Gerd Witzke kennen, der
bis zur Rente als Ingenieur für Wasserwirtschaft und Bauwesen in der
Wasserwirtschaft arbeitete. Das Paar heiratete am 24.5.1965 und hat
zwei Söhne. Die Familie wohnte zunächst in Lübben und zog später nach
Cottbus. Dort arbeitete Thea bis zu ihrer Rente beim Rat der Stadt.
.jpg)
Schulbild um 1947 vor dem Eingang der Kuschkower Dorfschule.
Es handelt sich um zwei Schulklassen, 14 Schüler, Konfirmation 1949. Oben rechts
ist Lehrer Wolfgang Strempel zu sehen, links steht eine der Hilfslehrerinnen,
die in den Nachkriegsjahren häufig wechselten. In der ersten Reihe vorn links steht
Dorothea Thiele, rechts neben ihr in kurzer Lederhose ihr Bruder
Siegfried Thiele, nach rechts weiter Hans-Herbert Dietrich,
Alfred Hecker und Gretel Hoffmann ganz rechts. Zweite Reihe von links Gustav Städter,
Kurt Michelchen, Hans Joachim Gustav Artur Majenz, Dieter Krenz und Günther Becker.
In der letzten Reihe von links Erika Gorchs (Hilfslehrerin), Lieselotte Beyer,
Ilse Mietke, Margot Hecker und Emmi Schrobback rechts außen. Weitere Kinder
dieser Klasse waren Sigrid Matschei, Elfriede (?) Kunze und Käthe Leutloff.
Weitere Hinweise zum Foto sind erbeten, Kontaktdaten siehe ganz unten. Mehr
Schulbilder gibt es auf der Schulchronik-Seite Teil 2. (Foto: Familienarchiv
Dorothea Witzke, geborene Thiele)
.jpg)
Siegfried Thiele und seine kleine Nichte Doris Jäzosch
um 1960 im Westberliner Zoo.
Quellen- und Literaturverzeichnis
Hinweis: Hier finden Sie nur Literaturangaben zum Inhalt dieser Seite im
weitesten Sinne. Das allgemeine Literaturverzeichnis
zu Kuschkow und der Niederlausitz als Thema der gesamten Website finden Sie auf der Hauptseite (Startseite,
siehe hier: ►).
Amtsbezirk Kay in der Provinz Brandenburg, Landgemeinde und Gutsbezirk, Übersicht über die
Verwaltungsstrukturen zwischen 1874 und 1945 unter www.territorial.de/markbran/zuellsch/kay.htm
Bahl, Peter: Belastung und Bereicherung.
Vertriebenenintegration in Brandenburg ab 1945. BWV Berliner
Wissenschafts-Verlag GmbH, Berlin 2020 (kostenlos zum Download unter
http://www.bwv-verlag.de). Mit einigen Informationen zur Unterbringung
von Flüchtlingen in den Baracken des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes
(RAD) in Kuschkow und im Kreis Lübben. Auch Jutta Jäzosch,
geborene Thiele, wird als Vertriebene im Buch mehrfach erwähnt (Seiten
1447, 1618, 1633). Leider wird ihr Name regelmäßig falsch als "Jäzoch"
geschrieben und ihr Geburtsdatum wird falsch mit 1939 angegeben statt
mit 1929. Auf Anfrage und Bitte um Korrektur zumindest bei der digitalen
Fassung teilt der Verlag am 5.10.2023 mit: "Es ist leider nicht möglich,
nur bei der digitalen Version eine Änderung vorzunehmen, weil Print und
Online gleich sein müssen." Keine Entschuldigung, nichts. Man weiß jetzt
jedenfalls, wie man die Angaben in dieser Publikation insgesamt zu
bewerten hat.
Benz, Wolfgang: Vom freiwilligen Arbeitsdienst zur Arbeitsdienstpflicht.
Enthalten in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 16 (1968), Heft 4 /
Oktober, Seiten 317-346; als PDF zu finden beim Institut für Zeitgeschichte unter
http://www.ifz-muenchen.de (siehe direkt hier:
►), das komplette Heft
findet man unter http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1968_4.pdf
Brandenburg um 1900 auf topographischen Karten des Deutschen Reiches / Messtischblätter M 1:25000,
im Internet zu finden bei © Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de), siehe direkt hier:
► und hier:
► ‒ hervorragend zum nahtlosen Navigieren durch die ganze Provinz Brandenburg
Brandenburgisches Landeshauptarchiv ‒ BLHA, im Internet
unter https://blha.brandenburg.de (siehe direkt hier:
►) mit Rechercheangeboten zu sämtlichen historischen
Dokumenten der brandenburgischen Landesgeschichte. Viele der Dokumente
sind inzwischen digitalisiert und per Internet frei zugängig, auch
diverse Fachbücher kann man sich als PDF-Dateien herunterladen.
Chronik der Gemeinde Kuschkow. Erarbeitet 2002 von Birgit Martin als ABM-Leistung im Auftrag
der Gemeinde Kuschkow. Umfangreiche Loseblattsammlung in einem Ordner, aufbewahrt und weiterverarbeitet zur
gedruckten Chronik durch Familie Gerhard Scheibe 2003 (siehe nächste Position).
Chronik der Gemeinde Kuschkow. Herausgegeben von der Gemeindevertretung Kuschkow zur
675-Jahrfeier 2003; Redaktion und inhaltliche Bearbeitung durch Familie Gerhard Scheibe; Kuschkow 2003
Deutsches Reichs-Adressbuch für Industrie, Gewerbe, Handel. Unter Benutzung amtlicher Quellen
herausgegeben vom Verlag "Deutsches Reichs-Adressbuch ..." GmbH, Berlin SW 68, Jerusalemer Strasse 46-49.
Band IV: Adressen-Verzeichnis. Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Grenzmark (Posen-Westpreussen), Schlesien,
Danzig, Ostpreußen. Ausgabe 1938 (Datenstand 1937). Digitalisiert von "Die Schlesische
Digitale Bibliothek" (¦l±ska Biblioteka Cyfrowa) in Kattowitz (Katowice) unter
https://sbc.org.pl/de/dlibra ‒ Kay auf Seite 7722 (PDF-Seite 942)
Dohm, Christian Wilhelm von: Denkwürdigkeiten meiner Zeit oder Beiträge zur Geschichte vom
letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 1778 bis 1806. Erster Band. Lemgo
/ Hannover, 1814. Auf den Seiten 534-584: Aktenstücke über die Müller Arnoldsche Rechtssache. (digitalisiert
z.B. von Google) Das Eingreifen Friedrichs II. in den Prozess war damals rechtskonform, es hat sich später
als Fehlentscheidung erwiesen aufgrund falscher Tatsachenbehauptungen durch den Müller Arnold und wurde
unter dem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. revidiert. Alle zu Unrecht Verurteilten wurden rehabilitiert
und aus dem persönlichen Vermögen des Königs entschädigt. Grundsätzliche und hochinteressante Informationen
zu dieser immer noch aktuellen Problematik gibt es auf der Website von Udo Hochschild unter
https://www.gewaltenteilung.de
Außerdem interessant: Hans Paul Prümm: Friedrich II. von Preußen und das Recht. Zeitschrift für das
Juristische Studium (ZJS), Ausgabe 1/2012, Seiten 24-37, zu finden unter www.zjs-online.com (siehe direkt
hier: ►)
Gemeindelexikon für den Stadtkreis Berlin und die Provinz Brandenburg. Auf Grund der
Materialien der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlichen
statistischen Bureau. Verlag des Königlichen statistischen Bureaus, Berlin 1898. Kreis Züllichau-Schwiebus
ab Seite 208, Kay auf den Seiten 208-209 und 212-213 (digitalisiert u.a. von Google)
Gemeindelexikon für den Stadtkreis Berlin und die Provinz Brandenburg. Auf Grund der
Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlich
Preußischen Statistischen Landesamte. Verlag des Königlichen Statistischen Landesamts, Berlin 1909.
Kreis Züllichau-Schwiebus ab Seite 226, Kay auf den Seiten 228-231 (digitalisiert von der Staatsbibliothek
zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz)
Geschichte der Stadt und des Kreises Züllichau. Von A. Splittgerber, Superintendent a.D.
Jubiläumsschrift (1527-1927). Selbstverlag, Druck und Kommission von Hermann Hampel & Sohn in Züllichau, 1927.
Digitalisiert zu finden auf der Website der "Digitalen Bibliothek Großpolens" in Poznan (siehe direkt hier:
►).
Kurze Beschreibung von Kay auf Seite 106
Grund- und Gebäudesteuerveranlagung 1865: Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung
im Regierungsbezirk Frankfurt a.O. Herausgegeben vom Königlichen Finanzministerium. Gedruckt in der Königlichen
Staatsdruckerei, Berlin 1869. Als PDF digitalisiert von der Staatsbibliothek zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz.
Gemeindebezirk und Gutsbezirk Kay im Abschnitt 17: Kreis Zuellichau-Schwiebus (ab Seite 10 = PDF-Seite 533, die
Buchseiten sind nicht durchnummeriert). Datenerfassung im Zeitraum 1862-1865.
Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus für die Jahre 1926-1941 findet man z.B.
auf der Website der "Digitalen Bibliothek Großpolens" in Poznan (siehe direkt hier:
►), zugängig auch über "Ahnen-Navi" (siehe direkt hier:
►), jeweils Stand 8.9.2025;
online lesbar, Download nur als DJVU-Dateien möglich (erfordert das Programm WinDjView auf dem
eigenen Rechner, von dort aus kann man es als normales PDF ausdrucken). Einzelne komplette Heimatkalender zum
Download als PDF gibt es auch bei der Stadt und Landesbibliothek Potsdam (siehe direkt hier:
►)
Heimatkreis Züllichau-Schwiebus, eine Organisation von Flüchtlingen
und Vertriebenen aus dem ehemals deutschen Kreis Züllichau-Schwiebus, Website unter
https://www.heimatkreis-zuellichau-schwiebus.de
Kaak, Heinrich: Die brandenburgische Ortsgeschichte in Personen,
Familien und ländlichen Schauplätzen. Brandenburgische Historische
Kommission e.V., Potsdam 2011; separat publiziert als "Leitfaden für
Ortschronisten in Brandenburg". Als PDF zu finden auf der
Website des Brandenburgischen Landeshauptarchivs unter
https://blha.brandenburg.de
Klockhaus Kaufmännisches Handels- und Gewerbe-Adressbuch des Deutschen Reichs 1935,
Band 1A: Groß-Berlin, Provinz Brandenburg, Grenzmark und Pommern, Mecklenburg. Klockhaus
Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei, Berlin 1935; Kay auf Seite 728. Digitalisiert von Google
Lehmann, Rudolf: Historisches Ortslexikon für die Niederlausitz.
Band 1: Die Kreise Luckau, Lübben und Calau. Erschienen im Selbstverlag des
Hessischen Landesamtes für geschichtliche Landeskunde, Marburg 1979; Kuschkow
auf Seite 185. Digitalisiert erschienen im Berliner Wissenschafts-Verlag 2011
Lübbener Kreiskalender (Kreis-Kalender) in historischen
Ausgaben ab 1913 (Stand Dezember 2022), digitalisiert als PDF mit vielen
interessanten Beiträgen auch zu Kuschkow und Umgebung, findet man auf
der Website der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam unter
https://opus4.kobv.de/opus4-slbp/solrsearch/index/search/searchtype/collection/id/18476
Scheibe, Gerhard: Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Kuschkow, Kreis Lübben.
Kuschkow 1978 (erschienen im Eigenverlag der Gemeinde zur 650-Jahrfeier)
Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Frankfurt a.d.O.
Aus amtlichen Quellen zusammengestellt. In Gustav Harnecker's Buchhandlung, Frankfurt a.d.O.
1844. Kreis Züllichau-Schwiebus ab Seite 237, Kay auf Seite 243 (Datenstand 1840, digitalisiert
von Google)
Vor 50 Jahren: Als Flucht und Vertreibung im Kreis Züllichau-Schwiebus begannen.
Auszüge aus Tagebüchern, Briefen und Aufzeichnungen. Im Auftrag des Heimatkreises Züllichau-Schwiebus
(Eigenpublikation) zusammengestellt von Lothar Meißner. Der Bericht von Jutta Jäzosch auf den Seiten 96-100.
Website "Fotografie und Architektur" (siehe hier:
►) mit Fotos
und Informationen zu historischen Gebäuden, Dörfern und Architekturobjekten; zur Dorfgeschichte in
Brandenburg allgemein sowie in Kuschkow siehe dabei die Spezialseiten:
- Dorfentwicklung in Brandenburg ‒ Teil 1, Kulturgut im ländlichen Siedlungsraum (siehe hier:
►)
- Dorfentwicklung in Brandenburg ‒ Teil 2, Gebäude, Baugestaltung, Natur und Landschaft (siehe hier:
►)
- Dorfentwicklung in Brandenburg ‒ Teil 4, Bauernhausarchitektur in Stichworten und Bildern (siehe hier:
►)
- Architekturfotos und einige Angaben zu Kuschkow (siehe hier:
►)
- Erwin Seemel: Bevölkerungs- und Wirtschaftsverhältnisse im Amt Lübben um 1720 (siehe hier:
►)
Seitenübersicht
► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten
► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch
► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435
► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz
► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953
► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit
► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955
► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959
► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow
► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute
► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687
► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842
► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine
► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945
► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960
► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965
► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960
► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden
► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
►
Historische Ortsansichten ‒ Teil 2
‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz
Impressum und Datenschutz
Letzte Aktualisierung dieser Seite am 16.9.2025
Dies ist die private Website von Doris Rauscher, 16548 Glienicke/Nordbahn, Kieler Straße 16,
Telefon: 0173 9870488, E-Mail: doris.rauscher@web.de
Copyright © Doris Rauscher 2021-2026
Hinweis zur Beachtung: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert
für Desktop-PC und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.